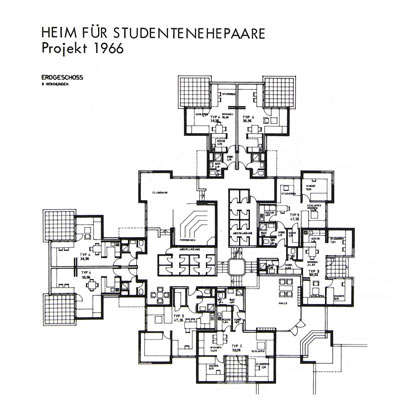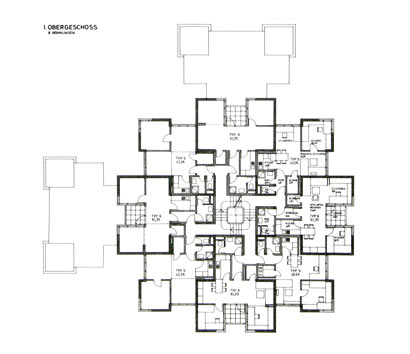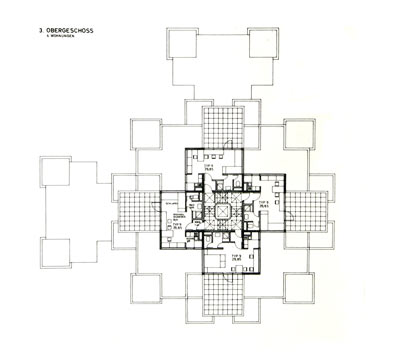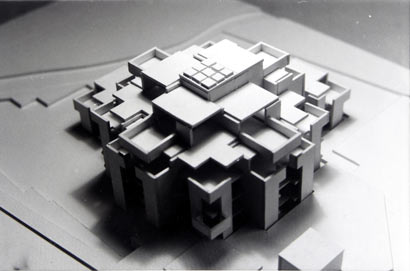|
WEGHAFTES. ARCHITEKTUR UND
LITERATUR
 HOME
HOME |
3.3  Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis
Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis
/ Wegphase 4 /
/ DER STRECKENHINWEG - Auf halbem Weg /

Die Ambivalenz in der Einschätzung
der Entfernung vom Heim und Annäherung an den angestrebten Ort beherrscht
den Streckenhinweg. Das Befinden auf halbem Weg pendelt zwischen dem Pessimismus
hinsichtlich des weiteren Wegverlaufes und dem Optimismus bezüglich
der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges auf ein Ziel hin. Unsicherheit
breitet sich aus angesichts des bevorstehenden `points of no return`.
Die latente Neigung zur vorzeitigen Rückkehr muss durch eine klare
Entscheidung für den Fortgang des Weges überwunden werden. Im
Entwurfsprozess ist die Entscheidung zwischen Alternativen erforderlich,
die in ihrer Wirksamkeit abzuschätzen sind. Der Entwurf bedarf einer
kritischen Analyse, wobei städtebauliche, architektonische, konstruktive
und wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Das Modell des
Architektenwettbewerbes mit neutraler Beurteilung fällt in diese
Wegphase.
3.3.4/
Auf halbem Weg wird die Ambivalenz von Heim- und Zielorientierung der
rationalen Überprüfung unterworfen, ob der eingeschlagene Weg
richtig ist. Das auf Sicherheit ausgerichtete Heimgefälle konkurriert
mit dem auf Erlebnisreichtum angelegten Zielgefälle. Der bisher geleistete
Einsatz wird mit dem zukünftig erhofften Gewinn in Beziehung gebracht.
Vor dem noch möglichen Punkt der Rückkehr wird eine Selbstbefragung
notwendig. Sie fordert eine Entscheidung.
|
|
/ 3.3.4 / Wegphase 4/ Projekte und Realierungen
/ Heim für Studentenehepaare, Graz (1966) /
..........

Heim für Studentenehepaare Graz
|

|

|

|

|

|

|
| |
|
|
|
/Heim für Studentenehepaare, Graz
[1966]/
Die Einladung zu einem beschränkt ausgeschriebenem Wettbewerb
zur Errichtung eines Heimes für Studentenehepaare führte
uns an die Grenze, die Beschränkung auf das Mögliche
verlangte. Die Auseinandersetzung der Jury mit alternativen
Konzepten musste vorweggenommen werden.
Ein Heim für Studentenehepaare stellt an den Wohn - und
Arbeitsbereich höhere Ansprüche als ein Studentenheim,
andererseits kann es keinem Wohnhaus für dauernden Aufenthalt
gleichkommen. Die Wohneinheiten sind für 2 Erwachsene
und 1-2 Kinder zu planen, zugleich muss ein beruhigter Arbeitsplatz
gegeben sein. Der ausgearbeitete Entwurf enthält 32 Wohneinheiten
von 30 - 60 m2, die durch Schiebewände den differenzierten
Anforderungen entsprechen.
Die Auseinandersetzung mit der städtebaulichen Situation
eines nahezu quadratischen Grundstückes mit Bezug auf
einen kleinen Platz unmittelbar neben dem Naherholungsgebiet
des Hilmteiches führte zu einer diagonalen Ausrichtung
des 3 - geschossigen Baukörpers zum öffentlichen
Raum. In gegenüberliegender Richtung folgt das Haus dem
fallenden Gelände zu einem Bach und nimmt die Geschossversetzung
als Weglinie in das Bauwerk hinein.
Zur selben Zeit arbeitete unser Freund, der Bildhauer Fritz
Hartlauer, an seiner "Urzelle". Aus der Physiognomie
des Kopfes als Schritte der Abstraktion entwickelt, schuf
er flächenhafte wie plastische Gebilde, die einer Überlagerung
eines orthogonalen und diagonalen Systems entspringen. Die
biologische Analogie zur Zelle versuchte er als Wachstumsperioden
entlang den Achsen eines Kreuzes zu veranschaulichen, das
er mit kosmischer Symbolik verband. Mit seiner Großplastik
bei der Weltausstellung 1967 in Montreal hat er dem konzeptiven
Gedanken monumentale Ausstrahlung verliehen.
Die architektonische Ausformung des Studenten-Ehepaareheimes
will keine Kopie der Urzellen - Plastik sein. Das Haus entwickelt
seine Struktur von innen nach außen, dennoch verbindet
beide das fraktale Prinzip der "Selbstähnlichkeit",
auf die Peter Weibel bei Hartlauer hingewiesen hat (32) .
Die reizvolle Umgebungssituation legte nahe, den Bewohnern
diese durch eine plastische Differenzierung des "Wohnberges"
durch Abstaffelung und vorgelagerte Terrassen zugänglich
zu machen.
Die Hindernisse der 4. Wegphase, die sowohl dem Raum als auch
der Zeit entspringen, ließen das Projekt auf halbem
Weg einfrieren. Das eingereichte Konzept überzeugte die
Jury durch Zuerkennung eines 1. Preises, jedoch der beabsichtigte
Träger des Projektes zog sich zurück und realisierte
es nicht.
Damit wird eine allgemeine Problematik des Architektenwettbewerbes
angesprochen. Fordern baukünstlerische Wettbewerbe vom
Architekten viel Einsatz in mentaler, physischer und wirtschaftlicher
Hinsicht, so sind sie als Mittel der Auftragsbeschaffung und
als Überlebensstrategie fragwürdig. Allein in der
idealistischen Umkehr des Leistungsprinzips der modernen liberalen
Gesellschaft erhalten sie ihre Bedeutung, für den Architekten
und die Gesellschaft. Insoferne sind sie künstlerische
Installationen ersten Ranges, die dazu auffordern, die reale
Welt zu hinterfragen. Der Gegenraum, die "echte Welt",
gründet in der Negation des Raumes, eben in der Poesie.
|
|
|