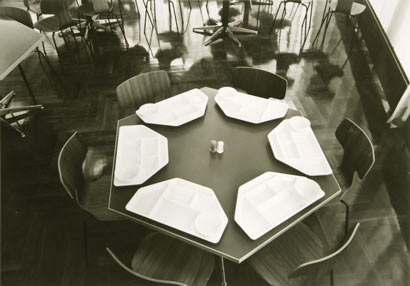WERKGRUPPE
GRAZ
 |
WEGHAFTES. ARCHITEKTUR UND
LITERATUR
 HOME
HOME |
3.3  Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis
Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis
/ Wegphase 2 /
/DER SCHRITT - Die Integration zum Start -
................................
/

Das Orientierungsbedürfnis
im Sinne einer gerichteten Bewegung leitet den aktiven Wegprozess ein.
Ihm liegt ein ökonomisches Abwägen zwischen dem Zielbegehren
und dem Wegaufwand zugrunde. Schon der erste Schritt trägt uns dem
Ziel entgegen. Dabei begegnen wir jenem Wechselphänomen, das analog
einem Wellensystem die kleinste Gesetzmäßigkeit im größten
Ablauf erkennen lässt. Das Prinzip der `Selbstähnlichkeit` in
der fraktalen Geometrie wird sichtbar. Der Schritt markiert den Beginn
der körperlichen Bewegung, die auf ein Ziel gerichtet ist. Dabei
ist zwischen dem direkten Weg der Linearität und dem indirekten Weg
der Umkreisung abzuwägen. Ein übergeordneter Aspekt der Wegbedeutung
wirkt herein. Als Entwurfsprozess betrachtet, ist den Umständen der
konkreten Umwelt als Suche nach einem optimalen `Ort-Weg-Raum` Rechnung
zu tragen. Der "genius loci" will erkannt, zugleich aber auf
sein räumliches Beziehungsnetz zurückgeführt werden.
 walking
walking boden.haft.ung © jö
|
|
3.3.2 /
Die Wechselbeziehung zwischen dem Objekt und seinem Umraum kennzeichnet
den Schritt. Einerseits wird er von einem inneren Wollen gesetzt, andererseits
von den äußeren Umständen aufgefangen. Dem Architekten
begegnet dieses Problem auf dem Wege seines Planungsprozesses, wenn er
sich auf das Ziel der Erfüllung einer Bauaufgabe richtet und sich
mit der Umwelt auseinandersetzt. Der Umraum, nicht allein das Baugrundstück,
tragen den Heimcharakter, aus dem ein Bauwerk herauswächst.
|
|
/3.3.2 / Wegphase 2/ Projekte und Realierungen
/ Studentenheim mit Mensa, Graz (1963)/
..........
|
|
|
|
/Studentenheim mit Mensa, Graz [1963]/
Für die Errichtung eines Studentenhauses mit Mensa
wurden wir 1963 zu einem Wettbewerb eingeladen, für
den wir den 1. Preis zugesprochen erhielten daraufhin mit
der Planung beauftragt wurden.
Das Raumprogramm umfasste ein Studentenheim für 135
StudentenInnen, eine Mensa und die Büros der Österreichischen
Hochschülerschaft der Universität Graz. Der Standort
zeichnet sich durch seine zentrale Lage im Universitätsviertel
aus, da er einerseits in der Blickachse der vom Stadtpark
herführenden Zinzendorfgasse liegt, andererseits eine
Grenzzone zwischen der geschlossenen gründerzeitlichen
Wohnbebauung des Bereiches und den großen, am Campus
freistehenden historischen Institutsbauten der Karl Franzens
Universität markiert. Das Baugrundstück ragt keilförmig
als Ausläufer einer Grünzone in den optisch wirksamen
Platzbereich - heute Sonnenfelsplatz - hinein.
Von Anbeginn der Planung war klar, dass ein bewusster Ausgleich
zwischen dem Zielgefälle und dem Heimgefälle des
Projektes angestrebt werden muss, da sich Projektaufgabe
und städtebauliche Voraussetzungen optimal ergänzten.
Zum einen ist das Haus gut erreichbar, zum anderen erfüllt
er unser Orientierungsbedürfnis als erkannter Ort.
Die Entwurfsidee entspringt dem Zusammenwirken von Aufragen
und Kreisen, von radialen und zirkularen Kräften analog
dem Entfaltungsprinzip der `Urpflanze` und findet im Sechseck
seine Verwirklichung. Dem Kreis angenähert, ist es
doch eine gerichtete Figur, die mit ihren Achsen und Seiten
Bezüge aufnehmen kann. Diese werden im Entwurf durch
die vorbeiführenden Straßen der Leechgasse und
Schubertstraße bezeichnet, denen das Sechseck des
Grundrisses sich einfügt. Die flächenhafte Ausdehnung
des Sechsecks mit der Optimierung der Fläche bezüglich
des Umfanges gewährleistet zudem ein ökologisch
vorteilhaftes Verhältnis von Wohn- zur Fassadenfläche.
Ein Aspekt, der später unter dem Einfluss der Energieknappheit
im Bauen zunehmend Bedeutung erlangte. Die beiden 4 bzw.
5 Geschosse umfassende Baukörper in versetzter Lage
fanden im Entwurf ihre Voraussetzung, da getrennte Heime
für Mädchen und Burschen vorzusehen waren. In
einer gemeinsamen Eingangshalle verbunden, nähern sie
sich in den Treppenhäusern der aufsteigenden Baukörper
auf Armeslänge an, um einen schmalen Sichtschlitz zu
dahinter liegenden Freiraum offen zu halten.
Das konstruktive System, aus der grundrisslichen Figur des
Sechseckes abgeleitet, interpretiert die Geometrie des auf
gleichseitigen Dreiecken von 365 cm Seitenlänge beruhenden
Polygons und strebt höchste Flexibilität der Raumgliederung
in den einzelnen Geschossen an. Die großräumigen
Ansprüche der Mensa im Erdgeschoss mussten in gleicher
Weise wie die Kleingliedrigkeit der Wohngeschosse Berücksichtigung
finden.
Anschaulich korrespondiert die Wegführung mit dem konzeptiven
Programm, da die Zugänge zu den einzelnen Raumgruppen
nur im Umkreisen erreicht werden. Die Frontalität zur
Achse der Zinzendorfgasse ist aufgehoben. Im Inneren lassen
die Hemmnisse der Funktionsteilung den "Umkehreffekt"
des räumlichen Erlebens hervortreten. Im besonderen
ist das beim Begehen der "ideellen Doppelwendeltreppe"
zu erfahren, die infrage stellt, ob man sich innen oder
außen befindet.
Wenn man die Hindernisse jener zweiten Wegphase, die den
Schritt des vorliegenden Entwurfes bestimmten, in ihrer
Impulsfunktion anspricht, dann war es der Konflikt zwischen
Großraum und Kleinraum. Auch darin kam es zu Widersprüchen
mit dem Bauherren, der eine anonyme Großmensa anstrebte,
während wir der räumlichen Gliederung als Ort
der "periodischen Beheimatung" des Essens den
Vorzug gaben. Einer ersten Niederlage folgte nach wenigen
Monaten die Rehabilitation, da die Mensa umgestaltet werden
musste, ohne ihren Raumcharakter zu verlieren. Mit der Planung
des Studentenhauses war unserem Büro erstmals ein Entwurf
gelungen, der in der Realisierung zugleich städtebauliche
und architektonische Ansprüche erfüllte. Ein erster
Schritt war getan, dennoch leuchtete ein programmatisches
Ziel vor uns auf - in den Diskurs mit den Nutzern zu treten,
die für uns Menschen "ohne Namen" waren.
|
|
|